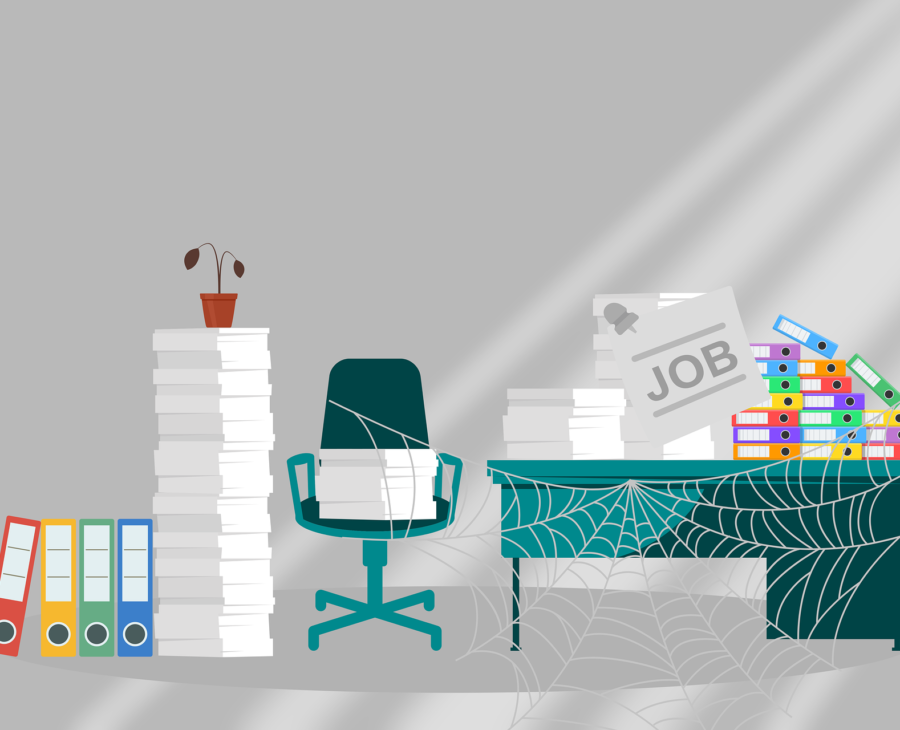Eine Intensivstation ist ein hochtechnischer Ort. Die Digitalisierung kann ihn für die Patientinnen und Patienten noch sicherer und humaner machen. Ein Gespräch mit Emanuela Keller, Ärztliche Leiterin der Neurochirurgischen Intensivstation am Universitätsspital Zürich.
Frau Keller, was ist eine neurochirurgische Intensivstation?
Wir bieten zwölf Betten für Patientinnen und Patienten, die beispielsweise einen schweren Schlaganfall oder eine Hirnblutung hatten und oft in Lebensgefahr schweben. Deshalb werden unter anderem die Hirnfunktionen, die Atmung und der Kreislauf dauernd überwacht – bis sich die Situation stabilisiert hat.
Eine Intensivstation ist demnach ein hochtechnischer Ort?
Das ist so. Intensivstationen gibt es seit den 1950er-Jahren. Von Anfang an ging es darum, mit Hilfe medizintechnischer Geräte Menschenleben zu retten. Zu Beginn waren das Beatmungsmaschinen und Geräte zur Herzüberwachung mittels Elektrokardiogramm, kurz EKG. Später kamen zusätzliche Geräte hinzu, etwa zur Überwachung der Blutzusammensetzung, zur Narkose oder Spritzenpumpen, die Medikamente abgeben. Die Intensivstation ist heute –zusammen mit dem Operationssaal – sicher der Ort, wo Technologie am direktesten Leben rettet.
Wie verändert die Digitalisierung die Intensivstation zusätzlich?
Die Intensivmedizin ist bereits seit den 1990er-Jahren digitalisiert. Damals kamen die ersten Geräte auf, die Daten nicht mehr analog, sondern digital verarbeiten, anzeigen und speichern konnten. Was in den vergangenen zehn Jahren hinzukam, ist vor allem die digitale Dokumentation der Krankengeschichten.
Auf einer Intensivstation fallen vermutlich sehr viele Daten an, wenn alle Vitalfunktionen eines Menschen überwacht werden?
Ja, vermutlich war die Intensivstation der erste Bereich der Medizin, in dem Big Data zum Thema wurde. Die Geräte auf unserer Station erzeugen pro Tag und Patient bis zu 60 Terabyte an Daten – also mehr als 60 000 Gigabyte. Die riesige Datenmenge ist an sich kein Problem, wir haben einen eigenen Supercomputer dafür. Die Frage ist, wie wir die für uns relevanten Informationen herausfiltern können. Dabei wiederum helfen uns neue Technologien.
Zum Beispiel Algorithmen oder Künstliche Intelligenz?
Ja, aber bevor wir diese einsetzen können, gilt es ein Problem zu lösen. Die Daten der verschiedenen Geräte auf einer Intensivstation müssen integriert, also zusammengefügt werden. Die heutigen Geräte exportieren ihre Daten in unterschiedlichen Formaten und können nicht miteinander kommunizieren. So kennt die Beatmungsmaschine die Herzfrequenz des Patienten nicht und das EKG-Gerät weiss nichts über den Sauerstoffgehalt im Blut. Entsprechend können diese Werte nicht miteinander in Bezug gesetzt werden. Eine wirkliche Digitalisierung im Gesundheitswesen erreichen wir so nicht.
Was braucht es dazu?
Man kann es vergleichen mit den verschiedenen Verfahren der Bildgebung wie Magnetresonanz-, Computertomographie oder PET-Bildgebung. Dort dauerte es rund 20 Jahre, bis sich die Gerätehersteller auf einen gemeinsamen Datenstandard einigten. Seit knapp 10 Jahren existiert ein solcher, was ein enormer Vorteil ist beim Austausch von Daten aus der Bildgebung. Dasselbe müssen wir auch für medizintechnische Geräte erreichen.
Wie realistisch ist das?
Ich bin überzeugt, dass das kommen wird. Die Gerätehersteller haben ein Interesse daran, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Geräte selber können kaum noch präziser werden, also werden sie andere Vorteile für die Nutzer aufweisen müssen. Und wenn ein Hersteller damit beginnt, werden die anderen nachziehen. Aber bis es soweit ist, arbeiten wir Universitätsspitäler bereits an entsprechenden Lösungen. Wir wollen zeigen, dass es machbar ist.
Wie sehen diese Lösungen aus?
Auf der Neurochirurgischen Intensivstation am Universitätsspital Zürich haben wir gemeinsam mit Partnern aus Hochschulen und Informatik das Projekt «ICU Cockpit» lanciert – ICU steht für Intensive Care Unit. Unser Ziel ist es, Big Data zum Wohle der Patientinnen und Patienten nutzen zu können. Künstliche Intelligenz – also Algorithmen – sollen uns helfen, die Daten so auszuwerten, dass wir voraussagen können, wie sich der Gesundheitszustand eines Patienten entwickeln wird. Und die Künstliche Intelligenz soll uns therapeutische Empfehlungen geben können. Dazu müssen wir aber, wie erwähnt, zuerst alle Daten der Geräte zusammenführen.
Wie weit ist das Projekt gediehen?
In einem ersten Schritt haben wir Algorithmen entwickelt, die es erlauben, das Risiko von weiteren Hirnschädigungen vorauszusagen. Das funktioniert im klinischen Alltag bereits. Jetzt gehen wir ein grosses Problem jeder Intensivstation an: Die grosse Zahl der Fehlalarme. Bisher löst jedes unserer Geräte einen eigenen Alarm aus. Jetzt gliedern wir die Messwerte der verschiedenen Geräte in Kategorien. So lässt sich besser erkennen, wann ein echter Notfall vorliegt – wenn beispielsweise bestimmte Messwerte der Atmung, des Herzens und des Gehirns gleichzeitig auffallend sind. Solche Situationen sollen in Zukunft auf einem zentralen Gerät einfach ersichtlich sein.
Funktioniert es bereits?
Wir haben die Algorithmen in unserem Simulationslabor getestet. Dabei ist es gelungen, die Zahl der Fehlalarme um einen Drittel zu senken. Allerdings haben wir gleichzeitig 12 Prozent der echten Alarme verpasst. Der Algorithmus ist also noch zu sensitiv. Deshalb werden wir jetzt einen zusätzlichen Algorithmus programmieren, der das ausgleicht. Denn das Ziel ist klar: hundertprozentige Sicherheit für die Patienten.
Sicherheit heisst, es dürfen keine Fehler auftreten?
Ja, aber das ist nur die eine Seite. Wir dürfen auch den menschlichen Aspekt nicht vergessen. Sicherheit erreicht man, indem die auf einer Intensivstation arbeitenden Menschen von stereotypen, ermüdenden Arbeiten entlastet werden. So haben sie den Kopf frei für den Kontakt mit den Patienten und Angehörigen oder können sich drängenden ethischen Fragen widmen. Insofern hilft die Digitalisierung auch, die Intensivstation humaner zu gestalten. Und Künstliche Intelligenz sorgt für mehr Ruhe, wenn Fehlalarme wegfallen. So können unsere Patientinnen und Patienten besser genesen und auch die Arbeitsqualität der Mitarbeitenden verbessert sich.
Werden Algorithmen in Zukunft auch die Therapie übernehmen? Also beispielsweise aufgrund der Messwerte die Menge an Schmerzmittel per Infusion steuern?
Nein, ich denke nicht, dass der Mensch in den nächsten 50 Jahren die Kontrolle über die therapeutischen Entscheide abgeben sollte. Dazu sind die Risiken zu gross. Aber wenn die Algorithmen uns Wahrscheinlichkeiten angeben, wie sich der Gesundheitszustand entwickelt und uns therapeutische Massnahmen empfehlen, ist schon viel gewonnen.
Wie wird die Digitalisierung in den nächsten Jahrzehnten Intensivstationen weiter verändern?
Ich bin überzeugt, dass sie die Mitarbeitenden entlasten und die Sicherheit der Patienten weiter erhöhen kann. Und sie wird helfen, die Kosten zu senken – Stichwort Telemedizin. Ich meine damit das Monitoring durch Biosensoren, die Patientinnen und Patienten am Körper tragen. So könnten sie zum Beispiel früher von der Intensivstation auf eine normale Pflegestation wechseln oder gar nach Hause gehen. Weil Biosensoren und Algorithmen einen bedrohlichen Zustand vorhersagen und wir entsprechend früh genug reagieren können.
Heute liegen Patienten manchmal rein präventiv zwei Wochen auf der Intensivstation, um allfällige Komplikationen frühzeitig erkennen zu können. Das ist nötig, weil sie auf einer normalen Bettenstation plötzlich bewusstlos werden könnten und es zu spät bemerkt würde. Mit Biosensoren und telemedizinischer Überwachung wäre dieses Problem gelöst.
Ist eine solche Telemedizin auch ausserhalb von Intensivstationen nützlich?
Absolut, ich sehe in der Digitalisierung ein grosses Potenzial. Sie wird sowohl den Menschen nützen wie auch Kosten sparen helfen. Dazu müssen wir die Prävention stärken, also verhindern, dass Menschen überhaupt in lebensbedrohliche Situationen geraten. Dank Telemedizin können wir intervenieren, bevor es dazu kommt. Gerade für Länder mit weniger Ressourcen ist das eine grosse Chance. In Afrika oder Indien beispielsweise gibt es ländliche Gegenden fast ohne Gesundheitsversorgung. Da könnte man mit Apps und Telemedizin die Gesundheit von Millionen von Menschen mit einfachen Massnahmen verbessern. Ein Beispiel: Den Blutdruck kann man in jedem Dorf messen, wenn ein Blutdruckmessgerät verfügbar ist. Mittels Telemedizin können die Dorfbewohnenden in Zukunft die nötige Beratung erhalten, um zu besprechen, ob der gemessene Blutdruck eine Behandlung nötig macht. Sehr viele Menschen besitzen ja heute auch in abgelegenen Weltgegenden Handys.
Sie sind zuversichtlich: Die Digitalisierung wird die Medizin weiter verbessern?
Ja, und in diesem Zusammenhang habe ich ein Anliegen an die Patientinnen und Patienten: Stellen Sie im Spital oder bei der Ärztin ihre – natürlich anonymisierten –Daten der Wissenschaft zur Verfügung. Nur so kann das Potenzial der Digitalisierung zum Wohle der Patienten voll genutzt werden.
Interview: Adrian Ritter, Kommunikationsbeauftragter USZ Foundation. Das Projekt ICU Cockpit wird unter anderem durch eine Schenkung des Unternehmers Dr. Hans-Peter Wild an die USZ Foundation ermöglicht.